Gedankenanstösse zur Mensch-Pferd-Beziehung
Erschienen im PASSION 01/21 von Ruth Herrmann
Was für eine Beziehung pflegen Sie zu Ihrem Pferd? Sind Sie Freund, Chef, Spielkamerad, Teammitglied? Als Mensch fehlen uns essentielle Fähigkeiten, die „Leitposition“ in einer Pferdeherde zu übernehmen. Daher ist es wohl besser ein verlässlicher Mensch und Trainer zu sein, statt zu versuchen ein unzureichendes Pferd zu werden. Denn gute Beziehungen mit Bindung und Vertrauen machen vor Speziesgrenzen keinen Halt.
Optimale Pferd-Mensch-Beziehungen werden von einigen Trainern beispielsweise als „Mini-Herde“ beschrieben, oder es wird darauf hingewiesen man müsse die „Alpha-Position“ innehaben. Das Konzept der «Leitstute» wird auch gerne bemüht. Allen diesen Bildern ist gemeinsam, dass sie sich nicht wirklich an der kritischen Wissenschaft orientieren, sondern stark vereinfachte Konzepte (->Gehirn und Denken) als Grundlage haben.
Das ist einer der Gründe, weshalb die ISES (International Society for Equitation Science) – eine internationale Gesellschaft von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen, welche sich mit den vielen diversen Fragen der Reiterei auseinandersetzen, – diese Praktik in ihrem Positionspapier „über den Gebrauch/Missbrauch von Leadership und Dominanzkonzepten im Pferdetraining“ kritisiert. Das soziale Zusammenleben von wildlebenden Pferden ist differenzierter. Weder ist der Haremshengst der uneingeschränkte Chef der Gruppe, noch gibt es eine Leitstute, welche kraft ihrer Weisheit die Herde anführt. Es ist vielmehr ein Zusammenspiel der individuellen Gruppenmitglieder.
Der Mensch ist niemals Pferd
In Pferdeherden findet kaum etwas davon statt, was Mensch-Pferd Interaktionen von in Gefangenschaft gehaltenen Tieren ausmacht: Pferde stellen keine Wände und Zäune auf, bringen einander kein Futter, Pflegen keine Hufe, Putzen keine unangenehmen Stellen, ganz zu schweigen von dem, was wir mit Pferden alles so machen.
Man ist sich in der Biologie ziemlich einig, dass Menschen keine Pferde sind und deshalb auch nicht Teil einer Herde sein können. Und ich wage zu behaupten, dass kein Pferd uns als Artgenosse wahrnimmt, dafür sind wir schlicht und einfach zu schlechte Pferde.
Wollen wir die Mensch-Pferd-Beziehung genauer analysieren und uns darüber Gedanken machen, erfordert das einerseits eine möglichst unvoreingenommene Betrachtung des Pferdes, die Anerkennung seiner Eigenständigkeit, seiner artspezifischen und individuellen Bedürfnisse und der Weise wie es diese Bedürfnisse äussert. Andererseits müssen wir uns über uns selber Gedanken machen. Wie denken wir über diese Beziehung? Wie handeln wir und wie sprechen wir im Alltag darüber? Als Menschen passiert es uns häufig, dass wir vermenschlichen. Vermenschlichung (=Anthropomorphismus) bedeutet, dass man Tieren oder Dingen menschliche Eigenschaften zuschreibt. Somit wird das Tier oder Ding zur Projektionsfläche. Gegenüber Pferden findet das in vielfältiger Weise statt, kann harmlos sein, aber auch problematische Züge annehmen:
Flehmen wird oft als Lachen gesehen, obwohl es mit dem menschlichen Lachen nichts zu tun hat. Es dient der Wahrnehmung von Pheromonen.
Ist ein Pferd „beleidigt“, das sich von uns abwendet? Es kann sich nicht dazu äussern, vielleicht ist es verwirrt oder ängstlich oder nicht motiviert?
Ist mein Pferd mein Freund? Oder gar mein Seelenverwandter? Mit einer solchen Einstellung wird dem Pferd seine Eigenständigkeit abgesprochen. Das ist übergriffig, weil das Pferd dazu herhalten muss, Abbild der menschlichen Befindlichkeit zu sein.
Ein Pferd scheut an einer bestimmten Stelle mehrfach. Reagiere ich anfangs noch geduldig, werde ich mit der Zeit ärgerlich. Ich finde, das Pferd dürfe nun keine Angst mehr haben. Kann man Angst verbieten? Hilft es dem Ängstlichen, wenn das Gegenüber ärgerlich wird oder gar zu Gewalt greift? Oder vergrössert das die Angst? Ist es der Fehler des Pferdes oder stosse ich mit meiner Kompetenzen als Trainerin und Reiterin an Grenzen?
Will uns ein Pferd veräppeln, indem es nicht tut was wir möchten? Solche Winkelgedanken sind sehr menschlich. Ist es wirklich fair und sinnvoll, dem Pferd schlechte Absichten zu unterstellen? Ich drehe den Spiess mal um: Wie fühlt es sich als Schülerin an, wenn die Lehrerin mir misstrauisch und rechthaberisch begegnet? Und wie wenn sie mir verständnisvoll erklärt, was die Aufgabe ist?
Entwicklung von Mensch und Pferd
Wie alle anderen Haustiere (darunter versteht man in der Biologie auch alle landwirtschaftlichen Nutztiere, also auch Rinder, Schafe, Schweine usw.) und auch wir Menschen sind Pferde soziale Tiere und haben die Fähigkeit, soziale Beziehungen über die Speziesgrenze hinweg zu etablieren. Menschliche und nicht-menschliche Tiere verschiedener Spezies können lernen sich zu verständigen und gegenseitiges Vertrauen (-> Vertrauen) zu gewinnen.
Pferde sind domestizierte Tiere, d.h. Menschen haben vor ca. 6000 Jahren damit begonnen, Pferde zu züchten. Funde belegen, dass Interieureigenschaften dabei eine wichtige Rolle spielten. Es wurden besonders zahme Tiere verpaart. Die Trainierbarkeit der gezüchteten Pferde wurde mit den zunehmenden Aufgaben, welche diese zu erledigen hatten, immer wichtiger.
Tiere, die wenig Aggressions- und Fluchtverhalten zeigen, sind einfacher zu trainieren. Sie sind lernfähiger, weil sie sich schneller an Neues gewöhnen. Weil Pferde für verschiedene Arbeiten genutzt werden, ist eine gute Assoziationsfähigkeit – also rasch und zuverlässig zu lernen, welches Verhalten in welcher Situation gewünscht ist, – ebenso wichtig. In den letzten etwas mehr als hundert Jahren wurden diese Lernformen von verschiedenen Forschern entdeckt und beschrieben. Sie werden in der Lerntheorie als klassische und operante Konditionierung bezeichnet. Die operante Konditionierung wird auch als Lernen durch Versuch und Irrtum oder Lernen durch Erfolg und Misserfolg bezeichnet. Durch Erfolg wird Verhalten belohnt, durch Misserfolg bestraft.
Bei guten Trainern kann man beobachten, dass Pferde sehr schnell schon auf feine Zeichen reagieren, sie lernen durch klassische Konditionierung, dass das feine Zeichen mit einer bestimmten Reaktion im Zusammenhang steht. Die klassische Konditionierung beinhaltet aber auch die Verbindung zur Gefühlswelt. Wird ein Pferd im Training verwirrt oder grob behandelt, so verbindet es diese Gefühle mit dem Training der Aufgabe oder schlimmstenfalls mit dem Training ganz allgemein. Es wird nervös, ängstlich oder aggressiv und wie wir Menschen auch, lernt es unter Stress viel schlechter. Dauert dieser Zustand lange an, kann es stumpf und abgelöscht werden.
Dominanz versus Lerntheorie
Weil Dominanzkonzepte die Haltung fördern, dass ich als Mensch mein Pferd dominieren, also unterordnen muss, wird grobem Umgang und Bestrafung Vorschub geleistet. Das macht diese Konzepte problematisch. Wird das Pferd als aufmüpfig, frech oder dominant wahrgenommen, muss man es in seine Schranken weisen. Die Einstellung dem Pferd gegenüber wird so von negativen Gefühlen geprägt. Das wirkt sich auf das menschliche Verhalten gegenüber dem Pferd aus. Die meisten neigen dann zu vermehrter Anwendung von Strafe (-> Strafe). Problematisch ist der Fokus auf das unerwünschte Verhalten, da erwünschtes Verhalten ignoriert und übersehen und damit nicht mehr belohnt wird.
Prof. Paul McGreevy von der Universität Sydney hat viele erfolgreiche Tiertrainer besucht und beobachtet. Er stellte in seinen Untersuchungen fest, dass allen zwei Eigenschaften gemeinsam sind: ein grosses Wissen über das natürliche Verhalten und die Bedürfnisse ihrer Tierspezies und eine sehr konsequente Anwendung der Erkenntnisse der Lerntheorie. Das bedeutet nicht zwingend, dass sie in einer Prüfung über Lerntheorie gut abschneiden würden, vielleicht haben sie in dieser Form noch gar nie davon gehört. Aber das was sie tun, lässt sich mit den Erkenntnissen, welche in der Lerntheorie zusammengefasst sind, belegbar erklären.
Die Lerntheorie ist keine Ausbildungsmethode, es sind Erkenntnisse darüber, wie Lernen und Training funktioniert. Sie zu kennen, hilft das Training zu verbessern, unabhängig vom Reitstiel oder von dem was ein Pferd lernen soll. Ziel ist immer ein sicheres, schonendes und ethisches (->Ethik) Training.
Die Reiterei stellt zusätzliche Ansprüche an Pferd und Mensch. Die Pferde müssen lernen, sich mit dem zusätzlichen Reitergewicht auszubalancieren. In informiertem und umsichtigem Training erklären wir dem Pferd die dafür nötigen Zeichen und trainieren notwendige Muskeln. Als Reiterinnen und Reiter gilt unser Bemühen, eine möglichst wenig störende Traglast zu werden und unserem Pferd die Balance zu ermöglichen. Körperliche und geistige Losgelassenheit entsteht nie durch Zwang.
Gehirn und Denken
Der gesamte Bauplan von Menschen und Säugetieren ist grundsätzlich gleich, Menschen sind Säugetiere. Auch die Gehirne sind prinzipiell gleich aufgebaut, unterscheiden sich aber in teilweise wesentlichen Details. Wie alles am biologischen Bauplan hat es sich in Jahrmillionen entwickelt und den Bedürfnissen der Spezies angepasst. Das Gehirn benötigt sehr viel Energie, es ist das „teuerste“ Organ. Es ist für das wirklich nötige ausgestattet und enthält keinen Luxus. Deshalb denken Pferde wie herdenlebende Fluchttiere, deren Futter so ziemlich überall wächst. Wir Menschen haben deutlich grössere Gehirne. Insbesondere die Hirnrinde im Stirnbereich ist viel stärker ausgebildet und sie dient beispielsweise dem Vorstellungsvermögen, der Planung und der Impulskontrolle. Diese Fähigkeiten sind essentiell für einen guten Trainer, eine gute Trainerin!
Weil Denken aber anstrengend ist, gibt es im Gehirn diverse Sparfunktionen. Eine ist die Gewohnheit, eine andere das Kategorisieren, was man als „Schubladendenken“ bezeichnen kann. Wir alle wissen, dass es anstrengend ist, Gewohnheiten zu ändern und bequeme Denkmuster und Kategorien aufzubrechen. Deshalb halten sich auch in der Pferdewelt längst widerlegte Vorurteile hartnäckig und deshalb schreibe ich diesen Artikel.
Verständigung
Grundlage einer guten Pferd-Mensch-Beziehung ist eine erfolgreiche Verständigung beider Spezies. Ich verwende absichtlich nicht das Wort „Sprache“, denn die Sprache mit der wir uns unterhalten und mit der ich diesen Artikel schreibe ist ein menschliches Phänomen – Pferdezeitschriften werden nicht von Pferden gelesen. Auch im Tierreich existieren Formen von abstrakten Zeichensystemen und kommunikativen Handlungen die gewisse Eigenschaften mit der menschlichen Sprache teilen. Von Pferdesprache zu sprechen, birgt aber viele Gefahren der Vermenschlichung (-> Haupttext). Deshalb spreche ich lieber von Verständigung zwischen Mensch und Pferd.
Bestrafung
Bestrafung im menschlichen Sinne hat immer auch eine moralische Komponente, es wird jemand für ein Fehlverhalten gemassregelt. Das hat auch mit der menschlichen Psychologie zu tun. Jemanden zurecht zu weisen, also zu bestrafen ist für Menschen belohnend – in ihrem Belohnungszentrum im Gehirn wird der Belohnungsbotenstoff Dopamin ausgeschüttet. Dies haben Forscher in verschiedenen Studien herausgefunden. In einem Spiel nehmen viele sogar einen Verlust in Kauf, wenn sie ihren Spielpartner für einen Regelbruch bestrafen können. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Durchsetzung sozialer Regeln in menschlichen Gesellschaften für den Zusammenhalt wichtig ist. Im Tiertraining und auch im coachen von Menschen ist aber Fehler sehen und bestrafen alles andere als hilfreich. Mit einer negativen Einstellung gegenüber dem Coachingpartner, sei es ein Pferd oder Mensch, gelingt es kaum, diesen sinnvoll zu fördern und bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Deshalb müssen wir den Fokus ändern und uns auf das konzentrieren, was wir erreichen möchten und in kleinen Schritten darauf hin arbeiten. Hierfür braucht es Vorstellungsvermögen, Planung und Impulskontrolle (->Gehirn und Denken).
Vertrauen
Braucht man diesen Begriff, wissen irgendwie alle was gemeint ist. Und doch ist es nicht ganz einfach ihn zu definieren und es gibt unterschiedliche Ansichten von Mensch zu Mensch. Deshalb ist es wertvoll und wichtig, zwischendurch darüber nachzudenken und das Gegenüber auch mal zu fragen, was es mit diesem oder anderen Begriffen genau meint. Vertrauen beinhaltet ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit in eine Situation oder gegenüber jemand anderem, das kann ein Mensch oder Tier sein. Fühle ich mich ruhig und sicher, spricht man auch von Selbstvertrauen. Forscher aus der Psychologie haben untersucht, wie Vertrauen bei Tieren und Menschen entsteht und sind auf eigentlich sehr einfach Zusammenhänge gestossen: Vertrauen entsteht durch Erfolgserlebnisse. Vertrauen lässt sich also durch viele kleine Erfolgserlebnisse aufbauen.
Ethik
In diesem philosophischen Teilgebiet wird menschliches Handeln nach moralischen Begriffen untersucht und bewertet. Man betrachtet es aus verschiedenen Perspektiven und argumentiert, weshalb es nun gut oder schlecht ist. Durch Abwägung der verschiedenen Argumente kommt man dann zu einer Bewertung. Jeder einzelne Mensch macht für sich ethische Abwägungen, aber auch eine grössere Gemeinschaft oder die Gesellschaft ist in ständiger Diskussion darüber. Die Bewertungen verändern sich mit der Zeit. Was früher noch allgemein akzeptiert war, wird heute kritisch beurteilt oder umgekehrt. Ist es richtig Kinder und Tiere zu schlagen? Was in der Nutzung und im Training von Pferden ist ethisch vertretbar? Die Diskussion darüber ist wichtig und sie sollte mit Argumenten geführt werden. Dass sie auch emotional wird, liegt in der Natur der Sache.






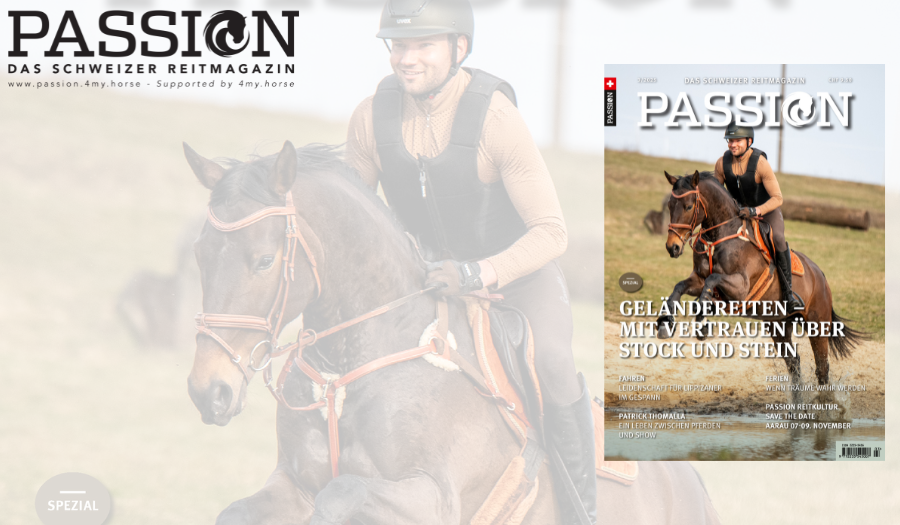




0 Kommentare