Erschienen im PASSION 02/21 von Marlitt Wendt
Stressbewältigung verstehen
In unseren unruhigen Zeiten wird nicht nur für uns Menschen das Thema Stressbewältigung immer wichtiger. Auch in Bezug auf unsere Pferde stellt sich die Frage, wie viel Stress vertretbar ist und an welcher Stelle eventuell einzelne Stressfelder vermieden werden können. Die Frage nach der Stresstoleranz ist nicht pauschal und universell auf alle Pferde bezogen gleichermassen leicht zu beantworten, da Stress und seine möglichen Folgen ein vielschichtiges Thema ist. Was für das eine Pferd eventuell nur eine geringe mentale Anregung ist, kann für das andere bereits eine totale Überforderung darstellen.
Manche Pferde gewöhnen sich leicht an diverse unterschiedliche Situationen und können einfach lernen sich auf dem Turnier oder im Pferdeanhänger zu entspannen, während für andere schon der Wechsel des Hufschmieds oder ein ungewohnter Reitweg im Gelände zur Herausforderung wird. Die gute Nachricht ist: Pferde können lernen stressige Situationen zu bewältigen. Und das gelingt immer dann am besten, wenn wir Pferdemenschen verstehen, wie die Stressverarbeitung bei Pferden grundsätzlich funktioniert, was für verschiedene Pferde-Persönlichkeiten mit welchen unterschiedlichen Stressbewältigungsstrategien reagieren und wie wir Stress frühzeitig erkennen um zu vermeiden, dass ein chronisches Stressproblem entsteht.
Was passiert bei Stress im Pferdekörper?
Ein Pferdeleben ganz ohne Stress wäre undenkbar. Denn Stress an und für sich ist nichts Gefährliches oder etwas, das es grundsätzlich zu vermeiden gilt, sondern ein ganz natürlicher Bestandteil des Lebens. Egal ob kurzzeitig ein lautes Geräusch das Pferd erschrickt, der Ausritt im Strassenverkehr bewältigt werden muss oder ein Stallwechsel ansteht. Ein gewisses Mass an Stress wird immer wieder entstehen und ist auch in der Natur so vorgesehen. Sowohl Pferde als auch Menschen haben einen körpereigenen Mechanismus, der sie dazu befähigt auf Umwelteinflüsse jeglicher Art zu reagieren und über spezifische physische und psychische Mechanismen ihre eigene körperliche und mentale Stabilität wiederzuerlangen. Immer wieder kommt es also dazu, dass das biologische Stress-System angesprochen wird. Immer dann, wenn Aussenreize das Pferd gewissermassen in Alarmbereitschaft versetzen, wird dieses System aktiviert. Das Pferdegehirn sendet dabei unterschiedliche spezifische Stresshormone aus, welche die Handlungsbereitschaft des Körpers verstärken. Dadurch erhöht sich beispielsweise der Blutdruck und der Puls, das Pferd wird aufmerksam und der Körper bereitet sich auf eine mögliche Flucht oder einen Kampf vor.
Mobilisation der Kraftreserven
Vereinfacht gesagt ist diese Stressreaktion eine Mobilisation der Kraftreserven des Körpers. Die Durchblutung wird gesteigert, die Muskulatur spannt sich an und alle Sinne werden auf Alarmbereitschaft geschaltet. Die Stressreaktion endet normalerweise mit einer Bewältigung. Sobald der Stress nachlässt, kommt das Pferd auch wieder zur Ruhe.
Ist der Stresspegel allerdings zu hoch und findet das Pferd keinen Weg mit der Situation zurecht zu kommen, kann aus der akuten Stressreaktion ein chronisches Stressgeschehen werden. Chronischer Stress beruht vor allem auf den über einen längeren Zeitraum andauernden starken Einfluss des Stresshormons Cortisol. In hoher Konzentration kann es vom Körper nicht so leicht abgebaut werden. Es ist auf Dauer gar problematisch und kann unter Umständen Schäden im gesamten (Nerven-) System verursachen.
Während kurzfristige Stress-Erlebnisse gut vom Pferd verarbeitet werden können und es dabei schnell zu seinem seelischen Gleichgewicht zurückkehrt, ist es gefährlich, wenn das Pferd permanent unterschiedlichen Stressauslösern ausgesetzt ist.
Chronischer Stress führt zu unterschiedlichen Krankheitsbildern wie Verdauungsprobleme, erhöhter Infektanfälligkeit, Verhaltensprobleme oder Depressionen. Immer wenn ein Pferd chronisch gesundheitliche Probleme hat, die sich nicht so einfach in den Griff bekommen lassen, würde ich persönlich auf die Suche gehen nach chronischem Stress im Pferdeleben. Dabei können neben vielen anderen Faktoren auch Überforderung im Training, Unstimmigkeiten in der Herde, ungünstige Haltungsbedingungen oder Fütterungsmanagement zu chronischem Stress führen.
Wie erkennt man Stress beim Pferd?
Da Stress eine Belastungsreaktion ist, erkennt man Stress immer an einer Erhöhung der emotionalen und körperlichen Spannung. Im ersten Moment wird das Pferd eventuell nur seine Atmung intensivieren und der Blutdruck wird sich erhöhen. Es wird seinen Kopf etwas anheben oder den Schweif leicht aufstellen. Später dann, wenn der Stresspegel steigt, sieht man stärkere stressbedingte Reaktionen wie Schwitzen, häufiges Äppeln oder Kopfaufwerfen. Dazu kommt die typische angespannte Stressmimik mit fester Kau-, Lippen- und Nüsternmuskulatur.
Wie ausgeprägt ein Pferd diese Anzeichen zeigt, hängt vor allem von seiner Persönlichkeit und seiner individuellen Art der Stressbewältigung ab. Wissenschaftlich nennt man die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien „Coping-Strategien“. Es gibt – vereinfacht gesagt – sowohl aktive als auch passive Stresstypen unter Pferden. Aktive Stresstypen, zu denen etwa viele Vollblüter und hochblütige Warmblüter gehören, reagieren unter Stress geschäftig und zeigen ihren Stress lebhaft nach aussen. Sie scharren, tänzeln, steigen oder wiehern verstärkt. Ein typischer, aktiver oder extrovertierter Stresstyp ist der klassische Vollblutaraber, der mit hochgestelltem Kopf und als Fahne getragenem Schweif herumtänzelt.
Das mentale Schneckenhaus
Der passive oder introvertierte Stresstyp hingegen bewegt sich unter Stress immer zeitlupenartiger. Er zieht sich quasi in sein mentales Schneckenhaus zurück und erscheint nach aussen zunächst relativ ruhig. Daher wird dieser Stresstyp so häufig auch von erfahrenen Pferdemenschen gar nicht als gestresst erkannt. Diese Pferde erscheinen auch unter grösseren emotionalen Belastungen zunächst brav und gelassen, können dann aber ganz plötzlich extrem explodieren. Sie empfinden innerlich nicht weniger Stress als die aktiven Stresstypen, sie zeigen ihn nur weniger offensichtlich. Den passiven Stresstyp findet man prozentual am häufigsten unter Kaltblütern und ursprünglichen Ponyrassen.
Je nach Zuchtziel werden unterschiedliche und teilweise leider auch ungünstige genetische Dispositionen mitvererbt. Eine solche Veranlagung für eine hohe Reaktivität ist beispielsweise für den Sport eine erwünschte Eigenschaft. Sie macht das Pferd sensibel auf Aussenreize und bewegungsfreudig. Genau diese Reaktivität kann allerdings in einer nicht sehr gut durchdachten Haltungsform leicht zu chronischem Stress und in der Folge zu Verhaltensstörungen führen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Koppen und Weben bei bestimmten Blutlinien unter Vollblütern häufiger vorkommen als bei anderen.
Wie stressresistent sind Pferde?
Wie viel Stress ein Pferd verträgt ist leider extrem unterschiedlich. Es hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Von seiner allgemeinen Konstitution, seiner körperlichen und psychischen Verfassung, von Haltungs- und Fütterungsbedingungen, Zufriedenheit, Alter, Rasse, Geschlecht und eben seiner genetischen Disposition.
Gerade Faktoren wie Schlafmangel, zu wenig Rauhfutter, unbefriedigtes Bewegungsbedürfnis oder Stress in der Gruppe werden oft lange übersehen, weil die Auswirkungen sich häufig nicht unmittelbar zeigen.
Hinzu kommt das Problem, dass die Haltung eines Pferdes immer teurer wird. Aus finanziellen Gründen werden daher oft mehr Pferde in eine Herde aufgenommen, als es beim jeweiligen Haltungskonzept angezeigt wäre. Die damit verbundene Enge, der Futterneid und Kennenlernstress verstärkt sich. Auch eine technisierte Haltung hat Licht- und Schattenseiten.
Schlafmangel als Ursache
Immer wieder gibt es Tiere, die mit automatisierten Vorgängen, dem Raumangebot innerhalb von Futterstationen oder den Geräuschen der Geräte nicht zurechtkommen und so Stress erleben.
Speziell auch der Schlafmangel kann entscheidend für das Wohlbefinden des Pferdes sein. Während die meisten Vertreter der Robust-Rassen relativ unkomplizierte Liegebedürfnisse haben, kann es sein, dass hochblütigere Pferde sich auf zu nassem oder zu hartem Boden oder bei zu geringem Raumangebot selten oder gar nicht hinlegen und sich dadurch zu wenig ausruhen, entspannen und schlafen. Die Folge ist chronischer Stress, der wiederum zu einem veränderten Schlafverhalten führt: Da sie permanent unter einer erhöhten Spannung und Aufmerksamkeit stehen, legen sie sich seltener hin. Sie schrecken auch leichter aus dem Schlaf auf und schlafen weniger tief und erholsam.
Wie reduziere ich Stress?
Kurzfristig kann ich versuchen Druck aus einer Situation herauszunehmen, positive Erlebnisse zu vermehren und mich auf Ursachenforschung begeben. Langfristig ist es wichtig einen Stress-Reduktionsplan aufzustellen, der sämtliche Lebensbereiche umfasst. Je weniger negativer Stress insgesamt, desto besser. Dabei sollte man sich an der Natur des Pferdes orientieren. Je mehr die Haltung, Fütterung und Anforderungen dem natürlichen Verhalten des Pferdes entsprechen, desto weniger stressbedingte Probleme wird es geben.
Dabei ist auch das planvolle Gewöhnen an die unterschiedlichsten Reize wichtig. Langsam und stetig, mit positiven Erfahrungen und Belohnungen verknüpft, kann sich das Pferd an viele Reize gewöhnen. So ergibt sich bei den meisten Pferden ein gesundes Mittelmass. Es soll weder von der Aussenwelt abgeschirmt noch durch zu viele Reize überfordert werden.
Erwartungshaltung des Menschen
Was Pferde unterschwellig stresst ist oft eine Erwartungshaltung des Menschen. Pferde sind sehr sensibel und können ihr Gegenüber sehr gut lesen. Sie fühlen, wenn der Mensch selbst unter Stress steht und diesen mit in den Kontakt zum Pferd bringt. Auch eine überspielte Unsicherheit kann zu Stress beim Pferd führen.
Pferde reagieren äusserst sensibel auf feinste Veränderungen der emotionalen Grundstimmung und nehmen über ihre besonders leistungsfähigen Sinnesorgane auch kleinste Abweichungen von ihrem gewohnten Lebensumfeld sofort wahr.
In unserer heutigen Lebensrealität wirken permanent „Stressoren“ auf die Pferde ein, auf die sie von Natur aus so nicht vorbereitet sind. In der Natur würden Pferde ihren Aufenthaltsort und ihre Herdenzugehörigkeit selbst mitbestimmen. Sie haben keine angeborenen Stressbewältigungsstrategien für ein Miteinander mit vielen anderen, ihnen zunächst unbekannten Pferden auf engstem Raum. Es entspricht nicht der Natur des Pferdes ständig aus dem einen Herdenverband herausgerissen und in eine andere Gruppe integriert zu werden.
Stresspotential Stallwechsel
Jeder Stallwechsel birgt ein enormes Stresspotenzial für alle Beteiligten. Das aus seiner bisherigen Umgebung gerissene Pferd erlebt Stress in der neuen Umgebung und ist gezwungen sich neu zurechtzufinden und neue Verbindungen zu knüpfen. Die Zurückgebliebenen trauern um ihr verlorenes Herdenmitglied. Und die neue Gruppe sieht im Neuankömmling eventuell einen potentiellen Eindringling, der das soziale Gefüge auf den Kopf stellt. Sicher lässt sich nicht jeder Umzug vermeiden. Aber bei der Entscheidung, ob überhaupt eine Notwendigkeit zum Stallwechsel besteht, sollte man Sorgfalt walten lassen. Pferdefreundschaften werden in der Natur sehr stabil angelegt und oft über Jahrzehnte gepflegt.
Futter steht dem Pferd in freier Wildbahn entweder sowieso zur Verfügung oder es kann sich frei bewegen und sich auf die Suche nach geeigneten Futterstellen begeben. In menschlicher Obhut führen die häufig räumliche Enge und ein begrenztes Futterangebot oft zu sozialen Spannungen, welche besonders empfindliche Pferde nicht kompensieren können. Viele Vierbeiner sind auch von den Anforderungen ihrer Menschen überfordert oder durch die gewählte Ausbildungsmethode frustriert.
Um mögliche Problemfelder frühzeitig zu identifizieren und Stress weitgehend zu vermeiden helfen ausführliche Fragekataloge, die es intensiv abzuarbeiten gilt.
Fragen wie „passt vielleicht ein bestimmtes Pferd mit seinen inidividuellen Bedürfnissen oder durch sein Verhalten nicht in die bestehende Gruppe? Ist der Liegebereich ausreichend gross für alle Pferde? Gibt es Pferde die den Zugang zum Rauhfutter zu stark kontrollieren und andere nicht zur Ruhe kommen lassen?“ können in diesem Zusammenhang oft Aufschluss geben.
Je mehr wir versuchen uns in den Lebensraum unseres Pferdes und seinen Alltag einzufühlen, desto stressfreier und harmonischer können wir sein Leben gestalten. Dabei gilt, dass sich ein möglichst stressarmes, glückliches Pferdeleben immer an den individuellen Bedürfnissen orientiert. Und diese Bedürfnisse können sich naturgemäss auch im Verlauf eines Pferdelebens ändern. Daher ist es von grosser Bedeutung sich immer wieder die Fragen nach der Zufriedenheit des eigenen Pferdes zu stellen.






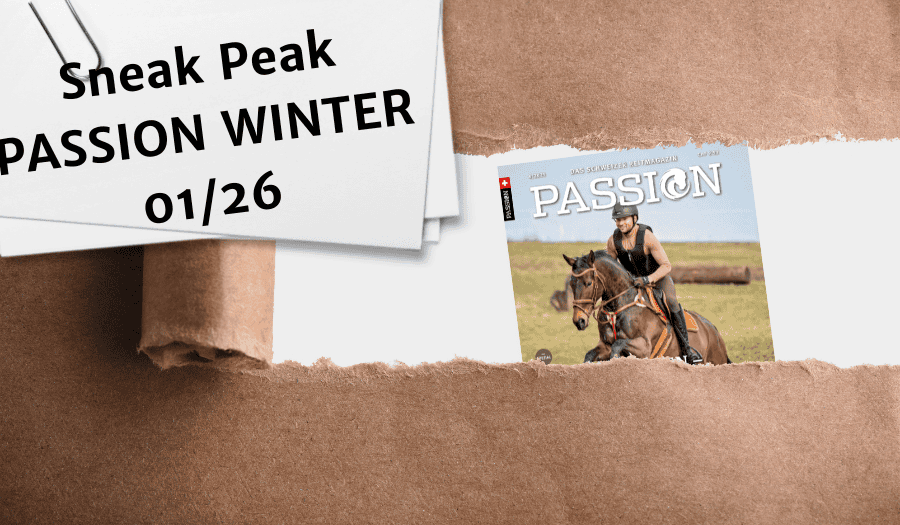




0 Kommentare